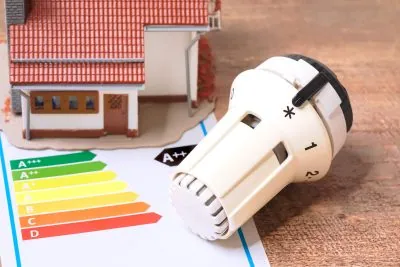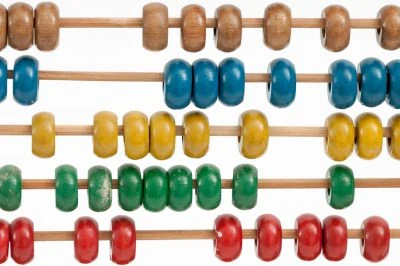Dr. Michael Pahle
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
„Man muss anerkennen, dass sich die Welt verändert“
Dr. Michael Pahle, Leiter des Arbeitspaketes Europa, spricht im Interview darüber, wie die EU in Zeiten von Deglobalisierung ihre Energieversorgung sichern kann und was passiert, wenn man Handelspolitik mit Klimapolitik verknüpft.
Michael, was ist das Spannendste, woran du derzeit arbeitest?
Das aus meiner Sicht Spannendste ist ein Block von zwei Themen. Das betrifft einerseits die europäischen Klimaziele. Da gibt es gerade eine Debatte über ein Zwischenziel bis 2040. Und die spiegelt sich auch auf nationaler Ebene wider, weil sich Deutschland dazu positionieren muss, welche europäischen Klimaziele es gerne hätte. Einer der kontroversesten Punkte im Koalitionsvertrag ist die Frage, ob man zur Erfüllung der Klimaziele auf deutscher und europäischer Ebene negative Emissionen und Gutschriften über Emissionsreduktion aus dem außereuropäischen Ausland anrechnen sollte. Das ist eine spannende Frage, weil Kritiker dort eine große Gefahr sehen, dass Klimaziele verwässert werden. Befürworter sehen wiederum die Notwendigkeit aus Gründen der internationalen Kooperation und Kosteneffektivität. Entsprechend ist es kontrovers, zumal es die grundsätzliche Ausrichtung der Klimapolitik ändern könnte. Damit in Verbindung steht andererseits die Frage, wie man den europäischen Emissionshandel weiterentwickelt. Wenn man solche Gutschriften oder negativen Emissionen anrechnen wollen würde, müssten diese zwangsläufig in den Emissionshandel eingebunden werden. Auf instrumenteller Ebene stellen sich hier also ganz konkrete Fragen.
Worum geht es in dem Arbeitspaket Energiesicherheit, Klimaneutralität und (De-) Globalisierung?
Wir beschäftigen uns mit der europäischen Klima- und Energiepolitik. Neben den Instrumenten und den Zielen ist das die Frage der Energiepolitik und der großen Vision für die Transformation. Da gibt es den European Green Deal, gefolgt vom Clean Industrial Deal, der im Wesentlichen sagt, dass wir Klimaneutralität im Jahr 2050 erreichen wollen und zwar so, dass Klimaschutz mit wirtschaftlichem Wachstum einhergeht. Da gab es auch schon viele Erfolge. Aber jetzt gibt es neue Herausforderungen: wirtschaftlich läuft es nicht gut, es gibt geopolitische Konflikte, es besteht ein hoher Finanzierungsbedarf. Wir beschäftigen uns damit, wie man diese Ziele erreichen, gleichzeitig dieses schwierige politische Feld navigieren kann und in dem Zusammenhang auch, wie die Interaktion mit der nationalen deutschen Klimapolitik aussieht. Wie muss sie sich ausrichten? Kann sie Vorreiter sein?
Mit welchen Methoden arbeitest du?
Wir haben eine ganze Reihe von Methoden. Wir sind mit das interdisziplinärste Arbeitspaket. Wir haben Ökonomen, Ingenieure, Politikwissenschaftler und Juristen. Ich kann vor allem für die Wirtschaftswissenschaften sprechen. Da wären die Methoden numerische Modellierung, aber auch Empirie sowie qualitative Analyse.
Seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ist das Thema Energiesicherheit ein Dauerbrenner. Wie abhängig ist Deutschlands Energieversorgung von anderen Staa-ten?
In Folge des Angriffskrieges wurde die Importabhängigkeit von Russland für Gas deutlich reduziert. Wir haben jetzt Gaslieferquellen in Norwegen oder Flüssiggas aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar. Da zeigt sich eine viel stärkere Diversifizierung. Andererseits steigen wir durch den Klimaschutz immer mehr auf Elektrizität um – Strom ersetzt Öl und Gas im Verkehr, in der Industrie und im Gebäudesektor. Grünen Strom können wir zum großen Teil heimisch oder europäisch produzieren. Beim grünen Wasserstoff sind die Importquellen noch diversifizierter. Das sind teilweise deutsche Projekte, die in Kasachstan oder Südamerika arbeiten. Wenn grüner Wasserstoff irgendwann in großen Mengen vorhanden sein sollte, wird man diesen aus vielen Ländern kaufen können. Insbesondere im Globalen Süden sind gute Standorte, um diesen mit Solarstrom zu produzieren.
Das bedeutet aber, dass wir bei unserer Energieversorgung immer noch auf andere Staaten angewiesen sind, oder?
Ja, bei fossiler Energie sind wir das. Wir haben in Europa kaum Öl und Gas und diese Energieträger wollen wir ja auch am schnellsten loswerden. Aber im Vergleich zu der Importabhängigkeit, die wir vor der Energiekrise hatten, insbesondere von russischem Gas, sind wir jetzt schon deutlich weitergekommen. Der Trend ist, dass wir immer weniger fossile Energie brauchen werden. Auf europäischer Ebene wurde außerdem diskutiert, ob wir eine europäische Beschaffung von Gas brauchen, weil wir eigentlich einen europäischen Energiebinnenmarkt haben. Alle grundsätzlichen Energiemarktregeln sind europäisch organisiert. Beispielsweise auch, ob wir neben der gemeinsamen Beschaffung von Gas eine gemeinsame Besteuerung von russischem Gas oder Öl brauchen. Diese Besteuerung könnte man beispielsweise differenziert nach Herkunftsland auf den europäischen Emissionshandel draufschlagen. Das sind die Energiesicherheitsfragen, die wir in unserem Arbeitspaket auf europäischer Ebene adressieren.
Donald Trump bringt mit seiner „America first“-Politik gerade vieles aus dem Gleichgewicht. Zölle, der Austritt der Vereinigten Staaten aus dem internationalen Klimaab-kommen. Erleben wir gerade eine Deglobalisierung?
In diesem Sinne schon. Es gibt einen wichtigen Indikator an dem man Globalisierung oder Deglobalisierung erkennen kann. Und das sind die Handelsströme beziehungsweise die Im-portzölle, die die USA gegen viele Länder gerade verhängen. Letzteres ist eine der Hauptaktivitäten von Trump seit seinem Amtseintritt und diese Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen und in den Konsequenzen nur schwer vorhersagbar. Aber nichts desto trotz kann man sagen, dass dieses Maß an handelspolitischer Konfrontation, plus der Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen, sehr stark für geopolitische Konfrontation sprechen. Das ist etwas, womit wir umgehen müssen und dafür brauchen wir insbesondere handelspolitische Instrumente, die auf EU-Ebene angesiedelt sind. Aber es gibt auch im Bereich des Klimaschutzes In-strumente. Beispielsweise den Grenzausgleichsmechanismus, der festgelegt, dass Importeure auf Güter aus Ländern ohne Klimapolitik einen Aufschlag zahlen müssen. Das sorgt für faire Wettbewerbsbedingungen. Dieses Instrument geht erst nächstes Jahr vollumfänglich an den Start, aber daran wird sich entscheiden, ob man Handelspolitik in Verbindung mit Klimapolitik umsetzen kann. Diese Frage ist von enormer Bedeutung, denn es geht am Ende darum, ob man Klimaschutz aus Handelskriegen heraushalten kann.
Wie kann Europa sich von diesem „Trend“ unabhängiger machen und gleichzeitig eine nachhaltige Energieversorgung sichern?
Das ist die große Herausforderung. In der anfangs erwähnten Zieldiskussionen kristallisieren sich zwei politische Fronten heraus. Die einen sagen, wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren, Klimaschutz national oder europäisch vorantreiben und die nötigen Energiequellen dafür selbst aufbauen. Das macht Sinn, wenn Weltstaaten dem eigenen Land gegenüber eher feindlich gesinnt sind. Aber es hilft nicht weiter, weil Klimaschutz eine globale Aufgabe ist. Die andere Seite sagt, wir müssen uns der Welt gegenüber öffnen, auch wenn es schwierig ist. Besonders gut lässt sich eben mit Freunden kooperieren. Und wir haben am Ende des Tages keine Alternative. Wir müssen mit Staaten im Globalen Süden kooperieren und auch jenen, die jetzt aufstrebende Wirtschaftsmächte sind, wie Indien oder Brasilien. Da muss man Übereinkommen schließen, die von gegenseitigem Nutzen sind. Das erfordert, das Europa bereit ist, in anderen Ländern für Klimaschutz zu zahlen. Aber es braucht dann auch die Garantie, dass dieser Klimaschutz hohe Qualität hat und annähernd die Standards von Europa oder Deutschland erfüllt.
In vielen Ariadne-Forschungsarbeiten spielt der CO2-Preis als Hebel für die Redukti-on von C02-Emissionen eine zentrale Rolle. Derzeit liegt dieser bei 55 Euro. Forschende rechnen aber damit, dass er wesentlich ansteigen wird. Wie realistisch ist es, dass der CO2-Preis tatsächlich so ansteigt, dass wir unsere Klimaziele erreichen?
Der CO2-Preis ist ein zentrales Element, weil er einen kosteneffizienten und technologieneutra-len Anreiz zur Vermeidung bietet. Aber es geht in erster Linie darum, die Zertifikate, die gleichbedeutend mit dem Recht zu emittieren sind, bis 2040 auf null zurückzufahren. Der Hinweis, dass der CO2-Preis aktuell unter dem liegt, was als notwendig beschrieben wird, ist berechtigt. Aber: Der Preis spiegelt immer die aktuelle Knappheit wider. Momentan werden immer noch mehr Zertifikate in den Markt gebracht als kurzfristig eigentlich benötigt werden. Weil in den letzten Jahren die Industrieproduktion aufgrund der wirtschaftlichen Rezession zurückgegangen ist. Das Instrument ist adaptiv, weswegen der Preis in so einem Fall nicht steigt. Zum anderen hängt es damit zusammen, dass Investoren und Unternehmer derzeit noch unsicher sind, ob es der EU gelingen wird, die Reduktion der Zertifikate in einem so schnellen Tempo politisch durchzuhalten. Auf Basis unserer Ariadne-Forschungsarbeiten interpretieren wir, dass der Marktpreis wesentlich höher sein müsste, wenn die Marktteilnehmer ohne Zweifel glauben würden, dass die EU das durchhalten kann. Ein Fokus unserer Forschungsarbeit ist daher auch, die Glaubwürdigkeit dieses Instrumentes zu stärken.
Wo steht Deutschland in Sachen Klimaneutralität deiner Einschätzung nach?
Ich glaube, dass Deutschland selbst eigentlich auf einem vernünftigen Weg ist. Es läuft nicht alles gut, aber wir haben in allen Sektoren etwas, womit man arbeiten kann. Besonders der Industrie- und der Gebäudesektor sind schwierig. Im Industriesektor haben wir auf europäischer Ebene den Emissionshandel und den Clean Industrial Deal, der explizit darauf zugeschnitten ist, den Industriesektor zu dekarbonisieren und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu halten. Da muss vieles eigentlich nur noch umgesetzt werden. Im Gebäudesektor haben wir das Gebäudeenergiegesetz, das eine ziemliche Welle geschlagen hat. Im Koalitionsvertrag steht, es soll abgeschafft werden. Aber das heißt nicht, dass alles davon komplett über den Haufen geworfen wird, denn auch da sind gute Elemente drin. Sinnvoll weiterentwickelt, haben wir hier einen starken Hebel. Und dazu wird noch der neue Emissionshandel kommen, der auch einen CO2-Preis im Gebäudebereich setzt. Es ist vieles angelegt, was sehr wirksam sein kann und es kommt jetzt darauf an, ob es gut reformiert und politisch durchgesetzt wird.
Wie blickst du in die Zukunft?
Ich kann nicht sagen, dass ich super optimistisch bin. Aber ich glaube, man muss anerkennen, dass sich die Welt verändert. Man kann sie nicht einfach einfrieren und das ist mit einer Grundfrage des Klimaschutzes verbunden. Dieser Wandel stellt viele Dinge in Frage, die wir kennen und wertschätzen. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist Wandel etwas, das immer da ist. Mein Lieblingszitat ist aus dem Buch „Der Leopard“ und es heißt: „Damit alles so bleibt, wie es ist, muss sich alles ändern.“ Ich glaube, wir müssen mit den Änderungen mitgehen, denn sie sind sowieso viel größer als alles, was wir kontrollieren können. Das macht mich auch optimistisch für den Klimaschutz. So wie wir ihn in den letzten Jahren angegangen sind, können wir angesichts der neuen Bedingungen nicht weitermachen. Man kann das lamentieren oder sich neu erfinden. Wie das genau aussehen soll, weiß ich noch nicht. Aber dann haben wir zumindest etwas, womit wir uns konstruktiv vorangehen können.
Das Interview wurde am 25.04.2025 geführt von Celine Koch.