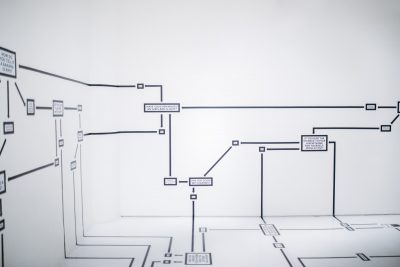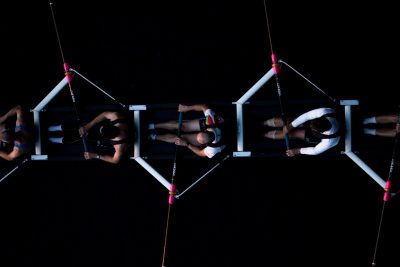Prof. Dr. Matthias Kalkuhl
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
„Klimapolitik ohne Verlierer“
Prof. Dr. Matthias Kalkuhl, Leiter des Arbeitspaketes „Verteilungsfragen und gesellschaftliche Trägerschaft“ im Kopernikus-Projekt Ariadne vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) erklärt, wie eine Klimapolitik ohne Verlierer aussehen würde und warum es so wichtig ist, innerhalb der Energiewende verschiedene Lebensrealitäten anzuerkennen.
Matthias, was ist das Spannendste, woran du derzeit arbeitest?
Wie wir die Klimapolitik global weiter voranbringen, insbesondere bei der aktuellen Krise der internationalen Abkommen und Institutionen. Es die Frage, wie wir es schaffen, dass am Ende alle an einem Strang ziehen und die globalen Emissionen sinken. Da sehe ich gerade die größte Herausforderung. Wir haben zwar das Paris Abkommen, aber die USA sind ausgestiegen und die anderen Länder erreichen ihre Ziele nicht. In Deutschland sind wir auf einem relativ guten Weg. Aber global besteht die Gefahr, dass andere Themen als der Klimaschutz eine höhere Priorität erfahren. Da müssen wir Lösungen bieten. Es ist spannend zu schauen, was Europa tun und mit welchen Verbündeten es neue Allianzen bilden kann, um die Emissionen effektiv global zu senken.
Worum geht es in dem Arbeitspaket Verteilungsfragen und gesellschaftliche Trägerschaft?
Der Themenschwerpunkt im Arbeitspaket 2 ist gar nicht so global, sondern beschäftigt sich mit der Energiewende in Deutschland und Europa. Die Ausgangsfrage ist, wie man es schafft, alle Menschen bei der Energiewende mitzunehmen; eine Klimapolitik zu konzipieren, die auf breite Akzeptanz stößt, keine finanziellen Härten verursacht, möglichst kostengünstig verläuft und trotzdem ihre Ziele erreicht. Die großen Themen sind Verteilungsgerechtigkeit und Akzeptanz. Wir schauen, wie man Kosten über verschiedene Bevölkerungsgruppen sowie über die Zeit verteilen kann – also auch Verschuldung ist ein Thema. Es geht um CO2-Bepreisung und Förderprogramme und wie diese finanziert werden.
Mit welchen Methoden arbeitest du?
Wir arbeiten einerseits empirisch und werten Haushaltsdaten aus. Andererseits arbeiten wir aber, wenn es um die Frage Verschuldung geht, auch mit makroökonomischen Modellen und schauen, welche Kosten über die Zeit anfallen oder welche Generation welche Kosten trägt. Dazu helfen uns konzeptionelle Modelle zu verstehen, wie beispielsweise eine Schuldenregel konzipiert sein muss, dass sie sicher ist gegen Missbrauch.
Wie verteilen sich die Kosten für die Energiewende derzeit?
Ein hoher Kostenanteil entfällt auf die aktuell lebende Generation, insbesondere also die Wählerinnen und Wähler, weil sie derzeit die Investitionen stemmen muss für den Umbau des Energiesystems, die Elektrifizierung, die Anschaffung von Elektroautos und Wärmepumpen. Innerhalb der aktuellen Generation verteilen sich die Kosten auf viele Gruppen. Stark betroffen sind die, die in einem schlecht isolierten Haus mit Gas- oder Ölheizung leben oder auf das Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu kommen. Diese Gruppen haben einen relativ hohen CO2-Fußabdruck. Bei ihnen fallen hohe Kosten an, wenn sie auf eine emissionsärmere Lebensweise umsteigen wollen. Daher ist es wichtig, dass für diese Gruppen eine finanzielle Unterstützung von der Regierung geleistet wird.
Wie würde eine optimale Verteilung der Lasten aussehen?
In einer Forschungsarbeit versuchen wir eine Klimapolitik ohne Verlierer auszubuchstabieren. Das Ziel ist, dass keiner schlechter dastehen soll als ohne Klimapolitik. Der Ausgangspunkt ist, dass Klimapolitik selbst einen großen Nutzen haben kann. Sie vermeidet Klimaschäden und sichert damit unser Wirtschaftswachstum. Dieser Vorteil fällt erst in der Zukunft an, deswegen ist es wichtig, über Verschuldung nachzudenken. Sie ermöglicht es, jetzt anfallende Kosten in Teilen auf die künftigen Generationen zu verschieben, die den Nutzen davon erfahren. Es ist sehr wichtig, zu fragen: Wer profitiert vom Klimawandel und wie können wir Kosten und Nutzen so verteilen, dass jeder mit einem Plus rausgeht? Das ist ein Baustein. Innerhalb der aktuellen Generation wäre das Ziel, keine Kosten anfallen zu lassen. Das ginge, indem wir erstens die Kosten durch die CO2- Bepreisung vollständig an die Bevölkerung und an die Wirtschaft zurückerstatten. Und zweitens indem Kosten für den Umstieg durch Förderprogramme kompensiert würden. Dieser Weg wäre steuerfinanziert. Die Steuermittel wären erstmal schuldenfinanziert. Die Schulden würden über die Zeit zurückgezahlt aufgrund der vermiedenen Klimaschäden. So ein Paket würde eine Klimapolitik ohne Verlierer möglich machen.
Wäre die Rückerstattung vom CO2-Preis das, was wir allgemein Klimageld nennen?
Genau. Wir haben das einmal konkret für den Gebäudesektor durchgespielt und Gebäudeklimageld genannt. Die Idee wäre, dass der CO2-Preis nur bei den Gebäudeeigentümern anfällt, da der eigentliche Hebel, die Heiztechnologie umzustellen, bei ihnen liegt. Sie würden dann auch das Klimageld bekommen. Und es wäre ein Gebäudeklimageld, weil es nach Gebäudetyp gestaffelt wäre. Denn es gibt große und kleine Gebäude und solche, bei denen die Umrüstung sehr einfach oder kompliziert ist. Mit dieser Schwierigkeit ist natürlich auch die Zeit verbunden. Bei manchen kann man sehr schnell umrüsten und müsste gar keinen CO2-Preis mehr bezahlen. Bei anderen muss man vielleicht noch Investitionszyklen abwarten und es fällt eine sehr lange finanzielle Belastung durch den CO2-Preis an. Die Eigentümer dieser Gebäude müssten sehr lange entlastet werde.
Bei der Ariadne Bürgerdeliberation erklärten Bürgerinnen und Bürger, sie hielten statt einer Rückerstattung des CO2-Preises die Investition der Einnahmen im Sinne der Energiewende für sinnvoller. Wie stehst du zu diesem Argument?
Das klingt erstmal plausibel. Wir haben in unserem Arbeitspaket auch Experimente durchgeführt, die zeigen, dass es eine hohe Präferenz für Förderprogramme und eine hohe Aversion gegen den CO2-Preis besteht. Das liegt zum Teil daran, dass die Kosten der CO2-Bepreisung so sichtbar sind. Bei Förderprogrammen ist den meisten Leuten gar nicht klar, woher das Geld kommt – dabei sind auch diese mit Steuererhöhungen oder ausbleibenden Steuersenkungen verbunden. Die Einnahmen bei einem CO2-Preis von 200 Euro, die wir bei einem rein preisbasierten Ansatz bräuchten, kann man nicht vollständig in Förderprogramme stecken. Um beim Beispiel Gebäudesektor zu bleiben: Das Problem ist, dass manche Eigentümer erst in zehn oder zwanzig Jahren umrüsten können. Wenn man dann 200 Euro CO2-Preis bezahlt, bewirkt das eine totale Schieflage und treibt Leute in den finanziellen Ruin. Bei den derzeit so niedrigen Beträgen braucht es kein Klimageld. Aber es wird dann virulent, wenn der CO2-Preis ansteigt.
Inwiefern müsste das Steuer- und Transfersystem angepasst werden?
Wir bräuchten zunächst eine Datenbank mit automatischer Einkommensprüfung, damit Förderprogramme für Haushalte mit geringem Einkommen einfacher umgesetzt werden können. Einkommensabhängige Förderprogramme sind meistens mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden. Auch beim Klimageld gab es die Debatte, es einkommensabhängig zu machen. Außerdem weiß der Staat nicht, wie stark wer vom CO2-Preis belastet ist. Dafür könnte man sich separate Systeme ausdenken, wie bei dem Gebäudeklimageld, wobei man einen Gebäudedatensatz bräuchte. In Deutschland läuft gerade ein Prozess für ein Gebäuderegister.
Wie vermeidet man Konflikte innerhalb der Gesellschaft im Sinne der Akzeptanz?
Das Beste wäre es, keine Verlierer zu schaffen. Es gibt Verteilungskonflikte, die dann entstehen, wenn es um Finanzierung geht. Da geht es um Fragen der Umverteilung. Wie viel Ungleichheit wollen wir zulassen? Wie können wir in einer Weise umverteilen, damit wirtschaftliche Anreize nicht zu stark in Mitleidenschaft gezogen werden? Umverteilung ist eine Art Sozialversicherungssystem, das jeden schützt, der Pech im Leben hat und von denen, die in bessere Gegebenheiten hineingeboren wurden gewisse Zahlungen abverlangt. Das ist der Gesellschaftskontrakt. Der Staat und unser Sozialsystem sind essentiell für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dafür, dass es keine exorbitant hohen Kriminalitätsraten gibt und Leute eine faire Chance haben, ihr Leben zu gestalten.
Es gibt auch Konflikte zwischen Stadt und Land oder Leuten, denen Klimapolitik am Herzen liegt und solchen, denen andere Sachen wichtiger sind. Es ist von Bedeutung, das anzuerkennen. Wir können nicht sagen: Leute, die auf dem Land leben, müssen jetzt selbst sehen, wie sie mit der Klimawende klarkommen. Das verstärkt die Polarisierung nur. Wir müssen diese Lebensrealitäten anerkennen und auch die Entscheidung, was Menschen in ihrem Leben wichtig ist. Und wenn das der Flug nach Mallorca ist, sollte das nicht als moralisch verwerflich erklärt werden. Es gibt natürlich große Klimaschäden, die anfallen und eine gewisse moralische Verpflichtung nachfolgenden Generationen gegenüber. Wir müssen einen Weg finden, der verträglich für alle ist. Kompromissbereitschaft und das Suchen nach Win-Win-Situationen sind essentiell.
Wie blickst du in die Zukunft?
Eigentlich recht zuversichtlich, weil das Problembewusstsein schon da ist. Es ist nicht einfach. Aber mit einer neuen Regierung haben wir jetzt wieder die Chance, Dinge anzupacken, vielleicht auch im Bereich Bürokratieabbau voranzukommen. Der nächste große Schritt ist, die internationale Klimapolitik weiter auszubauen, sodass wir nicht nur in Deutschland und Europa Klimaneutralität erreichen, sondern auch in anderen Schwellen- und Entwicklungsländern – und vielleicht irgendwann auch in den USA.
Das Interview wurde am 27.02.2025 geführt von Celine Koch.