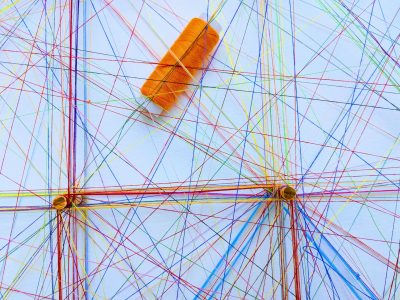Prof. Dr. Christian Flachsland
Hertie School
„Am Ende müssen die Emissionen nach unten gehen“
Prof. Dr. Christian Flachsland arbeitet im Kopernikus-Projekt Ariadne im Arbeitspaket „Mehrebenengovernance in einer neuen geopolitischen Konstellation“. Im Ariadne-Interview spricht er darüber, worauf es bei der Koordination von Klimapolitik ankommt und wie er auf das 1,5-Grad-Ziel blickt.
Christian, was ist das Spannendste, woran du derzeit arbeitest?
Das Spannendste woran ich gerade arbeite ist ein Rahmenwerk zur Konzeptionalisierung von Climate Politics als disziplinärem Feld. Also die Frage, wie wir die politischen Dynamiken von Klimapolitik, insbesondere auf nationaler Ebene, verstehen können. In diesem Rahmen geht es unter anderem auch um Mehrebenengovernance in föderalen Systemen, das heißt wie sich das Zusammenspiel zwischen Nationalstaat, Ländern und Kommunen in der Klimapolitik auswirkt. Ich würde die Mehrebenengovernance-Frage gerne mit breiteren politischen Dynamiken verbinden, also zum Beispiel dem Parteiensystem, Wahlen und Interessengruppen.
Das zweite Themengebiet ist internationale Klimapolitik, vor allem die Policy Frage. Hier geht es darum, was effektive Strategien sein könnten, um das Ambitionsniveau zu erhöhen – insbesondere angesichts dessen, dass es meiner Einschätzung nach relativ wenig gibt, um andere Staaten zu ambitionierterer Klimapolitik zu bewegen.
Was ist der Schwerpunkt deines Arbeitspakets?
Das Arbeitspaket hat zwei Schwerpunkte. Der eine ist Klimapolitik im Mehrebenensystem in Deutschland. Wir fokussieren uns darauf, wie nationale, länder- und kommunale Ebene zusammenwirken, wenn es beispielsweise um die Wärmewende geht. In Deutschland darf der Bund Kommunen zum Beispiel finanziell nicht direkt unterstützen, da laufen die Mittel über die Länder. Bei der kommunalen Wärmeplanung müssen die Kommunen wichtige Aufgaben selbst wahrnehmen. Sie brauchen finanzielle und personale Ressourcen, müssen Planungs- und Genehmigungsleistungen erbringen. Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien oder auch bei der Wärmeplanung müssen gewisse Standards implementiert und diese Implementierung überprüft werden. Wir stellen immer wieder fest, dass wir über diese Prozesse wenig wissen. Selbst deskriptiv sind Mehrebenenbeziehungen und die Frage, wie einzelnen Sektoren zusammenarbeiten gar nicht mal so klar. Das wollen wir mit unserer Ariadne-Arbeit ändern und damit die Policy Debatte über diese Fragen eröffnen und stärken.
Wie lautet der zweite Schwerpunkt?
Der zweite Fokus ist internationale Politik. Da haben wir im Herbst 2024 insbesondere für Deutschlands Klimaaußenpolitik reflektiert, was gut und was nicht so gut funktioniert hat. Im nächsten Schritt wollen wir schauen, mit welchen Optionen Deutschland Klimapolitik in anderen Ländern positiv beeinflussen kann. Dabei geht es natürlich auch darum, die EU und Deutschland mit Blick auf Wettbewerbsfähigkeit abzusichern.
Mit welchen Methoden arbeitet ihr?
In den Mehrebenenanalysen sind wir relativ interdisziplinär unterwegs, hauptsächlich jedoch in den Politik- und Rechtswissenschaften. International sind es Politik- und Wirtschaftswissenschaften.
Was genau ändert sich unter Friedrich Merz in Sachen Klima- und Energiepolitik?
Es ist noch sehr früh in der Legislaturperiode. Aber man kann schon sagen, dass Klima- und Energiepolitik keine überragende Priorität der aktuellen Bundesregierung zu sein scheint. Man sollte genau auf die Überarbeitung des Klimaschutzprogramms schauen, die laut Klimaschutzgesetz in den ersten 12 Monaten einer neuen Legislaturperiode erfolgen soll. Kürzlich kam die Meldung von einem Referentenentwurf, der die Gasspeicherumlage abschaffen, Gas also faktisch günstiger machen und das aus dem Klimatransformationsfonds finanzieren will. Das würde bedeuten, dass man Mittel aus dem Klimafonds nutzt, um die Gasversorgung zu sichern. Diplomatisch ausgedrückt ist das eine Zweckentfremdung von Mitteln, die für Klimaschutz vorgesehen sind. Aber das ist noch nicht beschlossen, also wird man genau hinschauen müssen. Auch beim Gebäudeenergiegesetz muss man abwarten, was abseits der Rhetorik tatsächlich passiert.
Noch wichtiger ist, auf EU-Ebene die Klimaziele nicht zu verwässern. Das heißt, das Fit-for-55-Paket beizubehalten, genauso wie die Integrität der Emissionshandelssysteme ETS 1 und ETS 2. Meiner Auffassung nach ist die Hauptaufgabe der aktuellen Bundesregierung, das und in diesem Zusammenhang auch die Sozialausgleichsfrage zu adressieren.
Aus Forschungsarbeiten, an denen du beteiligt warst, geht hervor, dass die Koordination von Klimapolitik sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene zu wünschen übriglässt. Weshalb?
International ist es zunächst einmal gar nicht so schlecht gelaufen. Es gab recht viel Koordination zwischen den Ressorts, und Klima als Querschnittsthema ist auch einfach eine schwierige Aufgabe.
National ist ein Problem das Ressortprinzip in Deutschland. Jeder Minister ist Herrscher in seinem Reich und der Bundeskanzler hat kaum Durchgriffsrechte. Und dann haben wir eine Koalitionsregierung, in der verschiedene Parteien beeinflussen, was der Minister macht. Wenn Parteien, die Klimaschutz nicht priorisieren, bestimmte Ministerien besetzen, dann passiert da einfach nicht viel in Sachen Klimaschutz. Da funktioniert zwar die technische Koordination auf der Arbeitsebene, aber die politische Koordination der Klimapolitik in der Bundesregierung nicht.
Wie sollte eine bessere Koordination stattdessen aussehen?
Eine gewisse politische Bereitschaft für ambitionierte Klimapolitik vorausgesetzt, schlagen wir vor, dass man die Bearbeitung des Klimaschutzprogrammes nicht mehr unter Federführung eines einzelnen Ressorts organisiert, sondern in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe. Dann hätte man nicht ein Ministerium, das seine Interessen durchsetzt, an denen sich alle anderen abarbeiten, womit man beim kleinsten gemeinsamen Nenner landet. Sondern eine positive Koordination, bei der es darum geht, Probleme gemeinsam zu definieren und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Insbesondere mit Blick auf die Problemsektoren Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft wäre das sinnvoll.
Klimaschutz rückt aufgrund akuter Krisen, Kriege und wirtschaftlichen Interessen immer mehr in den Hintergrund. Wie können die EU und Deutschland ihre Klimaziele, auch mit Blick auf internationale Partnerschaften, dennoch verfolgen?
Realpolitisch gesehen, war Klimapolitik leider immer schon ein marginales Thema. Die USA können wir kurzfristig gar nicht beeinflussen, China auch eher weniger. Im Wesentlichen kann man auf andere Staaten über zwei Wege Einfluss ausüben: Handel und Finanzen. Beim Handel haben wir den CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) und die Überlegung, diesen in einen Carbon Pricing Club zu überführen. Das würde bedeuten, dass es Länder mit einem gemeinsamen CO2-Preis und CBAM gibt, die damit den Emissionsminderungsdruck auf andere Länder erhöhen.
Bei der Klimafinanzierung sollte man strategischer hinterfragen, in welchen Entwicklungsländern oder „economies in transition“, Kooperationen Erfolg versprechend sind. Es ist gut, sich breit aufzustellen. Aber ab einem bestimmten Punkt macht es keinen Sinn mehr, überall ein bisschen Geld zu verteilen. Man braucht eine strategische Übersicht, damit man Mittel gezielt einsetzen kann. Man muss abwägen, inwiefern man durch Finanzierung von außen mit den innenpolitischen Zielen eines Landes Klimaschutzziele erreichen kann. Das ist ehrlich gesagt verdammt schwierig. Bei den bestehenden Partnerschaften mit Südafrika und Indonesien beispielsweise gibt es leider viel Streit und wenig Fortschritt.
Wo steht Deutschland deiner Einschätzung nach auf dem Weg zur Klimaneutralität?
Das ist nach Sektoren sehr unterschiedlich. Der Energie- und Stromsektor sehen gut aus, auch wenn es dort noch viele Herausforderungen gibt. Im Verkehrs-, Gebäude- und Landwirtschaftssektor sind wir bekanntermaßen nicht sehr gut unterwegs. Denn die Auswirkungen in diesen Bereichen spürt die Bevölkerung unmittelbar. Das ist politisch kein attraktives Thema. Als Bürger trägt man die unmittelbaren Kosten, wenn man Emissionen spart, beeinflusst das globale Klima aber kaum. Es passiert viel, die Emissionen gehen runter. Aber ich bleibe skeptisch, ob wir die nationalen Ziele wirklich erreichen. Ich schließe es nicht aus, weil auch da sehr viel von technologischer Entwicklung und Kostenreduktion abhängt. Am Ende erscheinen der Gebäude-, Landwirtschafts- und Mobilitätsektor am schwierigsten, weil es für die Verantwortlichen in diesen Sektoren nicht besonders attraktiv ist, Netto-Null-Klimapolitik zu machen.
Wie blickst du in die Zukunft?
Optimistisch, auch wenn ich sehr skeptisch bin. Es ist gut, dass wir das 2-Grad-Ziel haben, aber das 1,5-Grad-Ziel halte ich mittlerweile leider für zu ambitioniert und nicht mehr glaubwürdig. Die Wahrheit ist, dass die Emissionen global steigen, unter anderem die Kohleemissionen. Natürlich steigt auch der Zubau von Erneuerbaren und die Anzahl an Elektroautos auf den Straßen. Aber am Ende müssen die Emissionen nach unten gehen. In dem geopolitischen Umfeld aktuell ist das enorm schwer. Mit Blick auf Sicherheit kann Klimapolitik natürlich helfen, beispielsweise wenn es um Energieversorgung und Importabhängigkeiten geht. Aber da gibt es nicht nur Erneuerbare als Alternative, sondern auch Kohle, was für das Klima nicht gut ist. Ich hoffe, dass in all den Bereichen die Kosten sinken. Das kann klappen durch Innovationen, die wiederum durch gute Politikinstrumente angetrieben werden, die diese marktfähig machen. Ein Beispiel wäre die CO2-Bepreisung. Und dann müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen.
Das Interview wurde geführt am 20.06.2025 von Celine Koch.